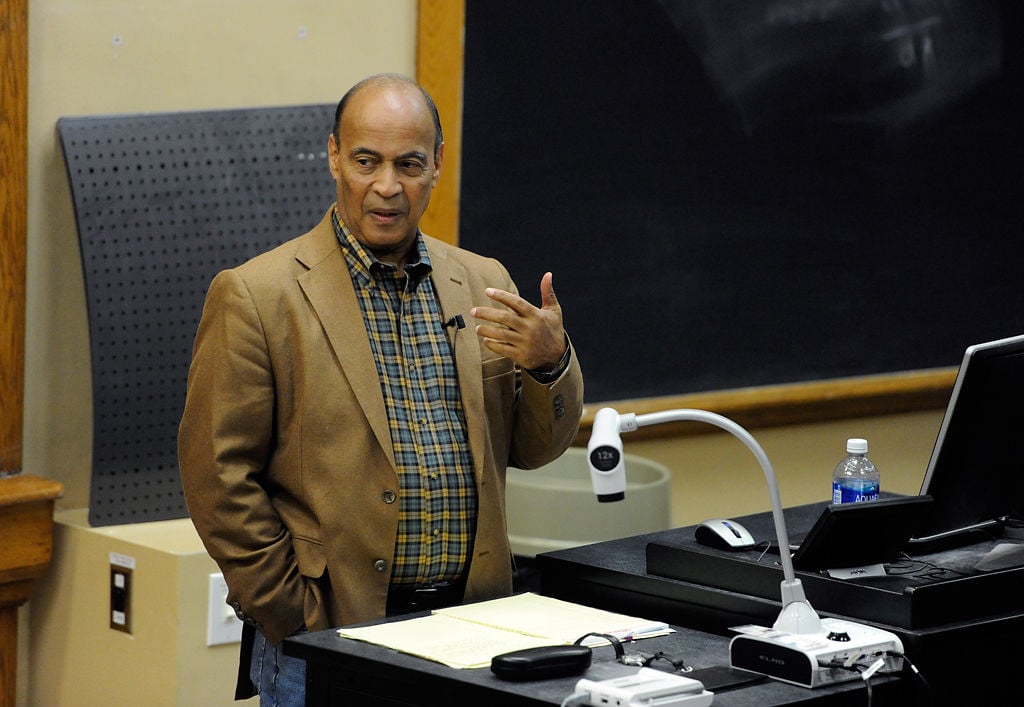 |
| Adolph L. Reed |
Magisch und magisch
Das Glückskonzept,
das wir der Rezeptionstheorie Adornos und der Sennettschen Kultur der
öffentlichen Darstellung zuschreiben, ist – als antinarzisstisches Prinzip – negativ
bestimmt. Zwar würden Versuche, die rituellen Formen des affektiven Austauschs,
die Sennett bei der Beschreibung des „Menschen als Schauspieler“ im Blick hat,
für die Gegenwart konkreter zu bestimmen, gar der Versuch, aristokratisch
geprägte, im 18. Jahrhundert gepflegte Formen der öffentlichen Darstellung wiederzubeleben,
Gefahr laufen, lächerlich zu wirken. Es lohnt aber, bei der von Adorno
empfohlenen Rezeptionshaltung zu Kunstwerken und bei der diesseitigen,
schauspielerischen Kunst der öffentlichen Darstellung im Sennettschen Sinn den Mechanismus jener „Glücksproduktion“ genauer
anzusehen.
Wir gehen ja, Adorno
folgend, davon aus, dass der Verzicht auf narzisstische und „grobsinnliche“ Kunstbeute
die Voraussetzung für Kunstglück bildet. Was aber, wenn überhaupt etwas, unterscheidet
das Glück, das diesem Verzicht folgen soll, von jenem, das etwa aus der Hingabe
an Wissenschaft oder Philosophie resultieren mag – falls wir Philosophie und
Wissenschaft überhaupt das Potential zuschreiben wollen, uns so etwas wie Glück
zu bescheren?
Mit Adorno
hatten wir oben die Kunst als eine „aus der Sphäre des bloßen empirischen
Daseins herausgegliedert[e]“ bestimmt. In der folgenden Vorlesungssitzung nennt
er den Bereich der Kunst einen „säkularisiert
magischen Bereich, das [sic]44 mit der empirischen Realität zwar
durch seine Elemente zusammenhängt und auf sie auch schließlich [...], kritisch
oder utopisch, sich bezieht, das aber nicht unmittelbar, soweit es ein
ästhetisches ist [...] selbst als ein Stück der leibhaftigen Wirklichkeit
erfahren wird [Hervorhebung von mir].“45
Die Charakterisierung
der Sphäre der Kunst als eine
(säkularisiert-)magische
impliziert das Tabu, sich dem Kunstwerk gegenüber so zu verhalten „wie wir
uns einer guten Speise – oder lassen Sie mich sagen: einem sehr guten Wein –
gegenüber verhalten.“46 Magisch ist hier ein Äquivalent von sakral. Angesichts des historischen Ursprungs
der Kunst im Bereich des Sakralen und des Magischen, und der Verknüpfung des Heiligen mit dem
Unantastbaren, wie sie im Begriff Tabu
begegnet, geht es Adorno um die, diesem „Ursprung im Heiligen“ geschuldete, Distanz
und Ehrfurcht gebietende, mitunter gefährliche47 Kraft, die von
Kunst als einem magischen – mittlerweile aber säkularisiert-magischen – Bezirk noch heute ausgeht. Dieser Tabu-Aspekt
der Kunst, auf den der Begriff magisch
hier verweist, entspricht der erwähnten negativen Bestimmung von Adornos antinarzisstischem Kunstglück-Konzept.
Bei der Suche nach
dem Mechanismus der „Produktion“ von Kunstglück bei Adorno scheint es aber aufschlussreicher,
sich an der alltagssprachlichen Bedeutung von magisch zu halten und an Assoziationen aus der Welt der Kindheit
und der Märchen – unter der Überschrift Zauberei.
Scheint uns doch die Unterscheidung
zwischen magisch und magisch – dem Magischen, das die Grenze
zwischen der Sphäre der Kunst und der des Empirischen anzeigt, und jenem Magischen
andererseits, das uns am Kunstwerk zu verzaubern und zu beglücken vermag – der
Antwort auf die Frage, was das für ein Glück sein soll, das die Kunst uns beschert,
und wie sie es uns beschert, näher
zu bringen. Auch indem sie auf die oben entwickelte erste Paradoxie des
Kunstglücks (erst der Verzicht auf narzisstische und „grobsinnliche“ Kunstbeute
ermöglicht Kunstglück) ein neues Licht wirft: Nur wer jene magische Grenze (magisch
im ersteren Sinn), die den Bereich der Kunst von dem empirischen trennt, anzuerkennen
bereit ist, kann am magischen Glück teilhaben (magisch im zweiten Sinn), das Kunst zu schenken vermag. Und es ist
der seit Jahrzehnten um sich greifende Verlust der Fähigkeit – und der
Bereitschaft – zu dieser
ästhetischen Distanz, der jene konkretistische
„Kunstauffassung“ gebiert, die uns in Zusammenhang mit den Debatten um Scaffold
und den Forderungen nach Trigger Warnings begegnet. Und die ihre Träger die
Kategorie des „Kunstschrecklichen“
verfehlen und Kunstwerke wie Scaffold
als etwas real Schreckliches
wahrnehmen lässt.
Die Kunstfremdheit Hegels
Bevor wir den gesellschaftspolitischen
Kontext dieser – die Kultur der Gegenwart prägenden – „Kunstauffassung“ näher in den Blick nehmen, ein Wort noch
zu der eben entwickelten, zweiten Bedeutung von magisch als einem für das Kunstglück wesentlichen Begriff. Ich
sagte, dass uns die Unterscheidung dieser zweiten Bedeutung des Magischen von
der ersten der Frage, was das für ein Glück sein soll, das die Kunst uns
beschert, näher zu bringen scheint –
mit Betonung auf scheint: Jeder
Versuch dies Magische im zweiten, „naiven“ Sinn über die mehr oder weniger
diffusen Assoziationen, die das Wort in jedem von uns auslösen mag, hinaus,
näher zu bestimmen, stößt auf jene Grenze des „je ne sais quoi“ („ich weiß
nicht, was“), die Marivaux schon 1734 zog, um Versuche, das Kunstschöne zu
objektifizieren, in die Schranken zu weisen. Auch sein Zeitgenosse, Johann
Mattheson, der große Musiktheoretiker des Barock, schlägt in eine ähnliche Kerbe, wenn er in seinem Standardwerk „Der
vollkommene Capellmeister“ zu Beginn des Kapitels „Von der melodischen
Erfindung“ schreibt: „Das ist ein
herrlicher Titel, wird mancher dencken [sic]: da muß es lauter schöne Einfälle
regnen!“,48 um dann die Frage der Lehrbarkeit der „Erfindung und
Verfertigung solcher singbarer Sätze“49, also von Melodien, grundsätzlich
zu verneinen – auch wenn er seinem Grundsatz in weiterer Folge dann untreu
wird.
Hatte dies „je
ne sais quoi“ bei der Bestimmung des Kunstschönen schon im 18. Jahrhundert Geltung
beansprucht, gilt es seit der radikalen Abkehr der Kunst des 20. Jahrhunderts
von konventionellen Formen umso mehr.
„Nun ist es aber bei der Kunst ganz sicher so,
oder bei der Frage nach dem Schönen überhaupt, daß sie gerade an diesem Moment
des [...] nicht ganz zu Greifenden, des nicht dingfest zu machenden ihr
Lebenselement hat.“50
sagt Adorno in der dritten Sitzung jener
1958/59 abgehaltenen Vorlesungen zur Ästhetik, um in Folge auf die Begriffe „Kultwert“
und „Aura“ bei Walter Benjamin zu verweisen. Und der ästhetischen Theorie
Hegels, dem er wesentliche Anregungen für seine eigene verdankt, vorzuwerfen,
sie würde, eben weil sie dieses Moment des Unbestimmten nicht würdige, die
Dimension der Erfahrung des
Kunstwerks zu verfehlen:
„Und es ist vielleicht doch gut, wenn ich schon jetzt sage, daß – so groß auch der Fortschritt ist, den Hegel in der Ästhetik durch die Subjekt-Objekt-Dialektik und das Hineinnehmen inhaltlicher Bestimmungen über den ästhetischen Formalismus des 18. Jahrhunderts gemacht hat –, daß doch dieser Fortschritt [...] bezahlt wird durch einen Moment [...] des Kunstfremden, mit einem Überschuß von Stofflichkeit, der manchmal dazu führt, daß man den Verdacht hegt, bei aller ihrer Großartigkeit ist diese Kunstphilosophie eigentlich der Erfahrung des Kunstwerks selber, die nun gerade in diesem Ephemeren besteht, gar nicht so ganz mächtig.“51
„Und es ist vielleicht doch gut, wenn ich schon jetzt sage, daß – so groß auch der Fortschritt ist, den Hegel in der Ästhetik durch die Subjekt-Objekt-Dialektik und das Hineinnehmen inhaltlicher Bestimmungen über den ästhetischen Formalismus des 18. Jahrhunderts gemacht hat –, daß doch dieser Fortschritt [...] bezahlt wird durch einen Moment [...] des Kunstfremden, mit einem Überschuß von Stofflichkeit, der manchmal dazu führt, daß man den Verdacht hegt, bei aller ihrer Großartigkeit ist diese Kunstphilosophie eigentlich der Erfahrung des Kunstwerks selber, die nun gerade in diesem Ephemeren besteht, gar nicht so ganz mächtig.“51
Während aber die tatsächliche oder
vermeintliche Kunstfremdheit Hegels auf dem tatsächlichen oder vermeintlichen Verfehlen
jenes magisch-ephemeren Moments am Kunstwerk gründet, also des magischen
Moments im zweiten Sinn, fehlt Trägern der heute verbreiteten konkretistischen „Kunstauffassung“ die Fähigkeit, jenes Moment des
Magischen am Kunstwerk zu erkennen, das die Grenze zwischen Kunst und dem
Bereich des Empirischen anzeigt. So gehen sie der Teilhabe am magischen Moment der
Kunst auch noch im zweiten Sinne verlustig.
Narzissmus
und Identitätspolitik
Proteste wie
jene gegen Scaffold oder gegen Dana
Schutz’ Gemälde Open Cascet,52
aber auch ein großer Teil der Forderungen nach Trigger Warnings erfolgen aus
identitätspolitischen Positionen heraus. Um Missverständnisse rund um einen, oft diffus verwendeten Begriff zu vermeiden: Identitätspolitik ist kein
anderer Name für den Kampf gegen die Unterdrückung von marginalisierten
gesellschaftlichen Gruppen und für deren Rechte. Vertretern von
Identitätspolitik ist es, im Gegenteil, um den – narzisstischen – Gewinn zu
tun, den die Unterdrückung „ihres“ jeweiligen Kollektivs abwirft. So gründet
die afroamerikanische Autorin Debra Dickersen Identität, Stolz und
Selbstachtung „ihres“ Kollektivs auf dessen Abstammung (sic!) von
westafrikanischen Sklaven. Weshalb sie Barack Obama, dem Sohn eines Kenianers
und einer weissen US-Amerikanerin, das „Schwarzsein“ abspricht.53
Und die – schwarze – britische Künstlerin Hannah Black forderte, Open
Cascet, ein Bild der – weissen – Künstlerin Dana Schutz, inspiriert von der
Fotografie der Leiche des 15-jährigen 1955 von Weissen gelynchten schwarzen
Jungen, Emett Till, nicht nur zu entfernen, sondern auch zu zerstören. Denn:
„[T]he subject matter“, schreibt Black, „is not Schutz’“.54 Auch
hier geht es nicht um die Beseitigung von
Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Sondern um den Gewinn, der sich aus der bloßen Thematisierung der Unterdrückung
eines Kollektivs ergibt, ein Thema, das IdentitätspolitikerInnen vom Schlage
Blacks eifersüchtig hüten wie einen Schatz. Die triviale Frage, woher Vertreter
der Identitätspolitik (in diesem Fall die zum Zeitpunkt der Kontroverse in
Berlin lebende Britin Hannah Black) die Legitimation beziehen, für die
Angehörigen „ihres“ Kollektivs (in diesem Fall für Millionen von
AfroamerikanerInnen in den USA) zu sprechen, wird meines Wissens kaum je gestellt.
Zu Ende
gedacht, läuft Identitätspolitik auf die Festschreibung von Diskriminierung hinaus.
In der Theorie – oft auch in der sozioökonomischen Praxis, wie der
afroamerikanische politische Theoretiker Adolph L. Reed, eindrücklich gezeigt
hat. Reed schreibt seit Jahrzehnten gegen den „race reductionism“ und jene
Identitätspolitik an, die Schwarze unter Ausblendung der Klassenfrage als
homogene Masse darstellt, und deren Nutznießer, wie er schon 1979 für den
Zeitraum zwischen den (späten) 1960ern und dem Ende der 1970er Jahre nachweisen
konnte, schwarze Eliten waren – und heute noch sind. Während sich die soziale
und ökonomische Lage unterprivilegierter Afroamerikaner (Reed zieht die
Parameter Beschäftigung, Kaufkraft, Wohnqualität und Lebenserwartung heran) im
selben Zeitraum weiter verschlechterte.55
Der Narzissmus
der Vertreter der Identitätspolitik, der sie die Kategorie Politik verfehlen lässt
– politische Politik, die reale Verhältnisse im Blick hat, nicht bloß imaginäre
Identitätskonstruktionen –, derselbe Narzissmus macht es denselben
IdentitätspolitikerInnen – qua konkretistischer Kunstauffassung – unmöglich, Kunstwerke
als Kunstwerke wahrzunehmen.
Um es in der Sprache
der Psychoanalyse, genauer der zweiten Freudschen Triebtheorie, zu sagen: Identitätspolitik
beschert ihren Vertretern einen Zugewinn an narzisstischer Libido, also an Stolz
und Selbstachtung, auf Kosten von Objektlibido, also des Interesses an real
existierenden Objekten und Strukturen – auf genau diesen Zusammenhang scheint ja Reeds Befund zu verweisen. Auch in
ihrer Begegnung mit Kunst bleiben AnhängerInnen der Identitätspolitik, sofern
das Dargestellte bestimmte in Zusammenhang mit „ihrem“ Kollektiv stehende
Emotionen zu triggern scheint, an ihrem Ich fixiert (Stichwort narzisstische
Libido), das seinerseits mit einem – imaginären – Kollektiv identifiziert ist,
ohne bereit oder in der Lage zu sein, die Grenzen dieses ihres „identitären“ Ichs
zu überschreiten. Und den objektiven (Stichwort
Objektlibido) Sinnzusammenhang des Kunstwerks wahrzunehmen. Von einer Hingabe
an das Kunstwerk, im Sinne Adornos ganz zu schweigen. So verfehlen sie das magische Moment in der Kunst, wie
gezeigt, im doppelten Sinn.
wird fortgesetzt
44 Laut Duden sind sowohl der als auch das Bereich richtig, im heutigen Sprachgebrauch überwiegt jedoch der
Gebrauch des Maskulinums.
45 Theodor W. Adorno, Ästhetik (Vorlesungen 1958/59),
Frankfurt am Main 2017, S. 187
46 Adorno, Ästhetik (Vorlesungen 1958/59), S. 178
47 Vgl. Sama Maani, Warum wir über den Islam nicht reden können. In ders., Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren
sollten. Und die eigene auch nicht, Klagenfurt 2015, S. 14
48
Ebd.Johann Mattheson, Der vollkommene
Capellmeister, Kassel 1995, S. 121
49
Ebd., S. 133
50 Adorno, Ästhetik (Vorlesungen 1958/59), S. 43
51 Ebd., S. 133
52 https://news.artnet.com/art-world/dana-schutz-painting-emmett-till-whitney-biennial-protest-897929
53 Vgl. Sama Maani, „Obama ist nicht schwarz“ – oder die Krux mit der Identitätspolitik.
In ders., Warum wir Linke über den Islam
nicht reden können, Klagenfurt 2019, S. 58
54 https://news.artnet.com/art-world/dana-schutz-painting-emmett-till-whitney-biennial-protest-897929
